Der Verein „DenkOrt Deportationen e.V.“ und die Stadt Würzburg freuen sich, der Öffentlichkeit am 16.6.2023 neun weitere Gepäckstücke am DenkOrt vor dem Hauptbahnhof zu übergeben.
Alle Bürgermeister*innen waren eingeladen. Neben dem OB Christian Schuchardt und Dr. Josef Schuster waren diesmal Prof. Ilona Nord und Judith Petzke vom antisemitismuskritischen Zentrum der evangelischen Theologie als Redner eingeladen. In einem Dialog wurden die unterschiedlichen Zugänge der Generationen zu solchem Gedenken angesprochen.
Eine Performance von Schülerinnen machte die Deportationsschübe anschaulich. Durch das Hinzutreten der Bürgermeister*innen zum „Beistand“ wurde eine neue Solidarisierung zu den damals ausgegrenzten Menschen anschaulich.
Der Termin 16.6. ist, wie so oft, ein trauriger. Er fordert uns zum Erinnern auf – an die Menschen, die als letzte größere Gruppe 1943 aus Unterfranken deportiert wurden. Dies war fast genau vor 80 Jahren.
Betroffen war die jüdische Restgemeinde in Würzburg, eine Gruppe von 64 Personen. 57 von ihnen wurden ins Vernichtungslager Auschwitz, sieben ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Nur eine Frau überlebte. Einige von ihnen – Iwan Schwab, Dr. Henny Stahl, Eugen Stahl – hatten als Gemeindefunktionär:innen die vorherigen Deportationen mit vorbereiten müssen. Andere, Krankenschwestern, Bäcker, Köchinnen, Gärtner usw. kümmerten sich um das Weiterleben der Menschen unter den Verfolgungs- und Kriegsbedingungen. Doch auch Kinder wie die Geschwister Weinberger oder der anderthalbjährige Sally Heippert gehörten zu der Gruppe.
Fotos der Gruppe von diesem Abtransport gibt es nicht. Bei der ersten Eröffnung des DenkOrts 2020 konnten damals individuelle Fotos von einem Teil der Deportierten gezeigt werden.
Wenn Sie sich über die jüdischen Gemeinden, aus denen die neuen Gepäckstücke kommen, informieren wollen, können Sie das bereits auf der Seite www.juf-gedenken.de tun.
Dort finden Sie unter jedem Artikel eine Liste aller Shoa-Opfer eines Ortes.
Die Gemeinden, die seit 16.6.2023 neu am DenkOrt in Würzburg vertreten sind:
Bad Königshofen mit Trappstadt
Estenfeld
Greußenheim
Großostheim
Schonungen
Schwebheim
Steinach a.d. Saale
Unterriedenberg mit Oberriedenberg
Wörth am Main
Text: R.R./M.St.
Bildnachweis: DenkOrt Deportationen – M.Stolz



 M. Stolz
M. Stolz Dr. Jürgen Kößler
Dr. Jürgen Kößler
 Riccardo Altieri, 11.09.2022
Riccardo Altieri, 11.09.2022 JSZ R.Altieri
JSZ R.Altieri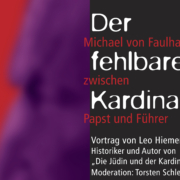 Alfred Bestle
Alfred Bestle